Wir gratulieren Karl Schlögel - Instytut Pileckiego
Wir gratulieren Karl Schlögel
...zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels!

„Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag, von der Ukraine zu lernen: furchtlos und tapfer zu sein – vielleicht auch, siegen zu lernen.“
Karl Schlögel, dem wir herzlich zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gratulieren, hat diese Auszeichnung mehr als verdient: zum einen für sein hervorragendes Schaffenswerk, das im Grunde genommen fast schon ein eigenes Genre darstellt, und zum anderen für seine moralische Klarsicht, der er auch gestern, fernab jeglicher falscher Ambivalenz, Ausdruck verlieh:
„Es gab zu viele Russlandversteher und nicht genügend Menschen, die Russland wirklich verstanden.“
An dieser Stelle erinnern wir daran, und bedanken uns dafür, dass Karl Schlögel, im Grunde genommen als einer der Ersten seiner Zunft, sich durch unsere erste Pilecki-Ausstellung im November 2019 führen ließ. Für uns, damals noch ein junges, noch nicht ganz so selbstbewusstes Institut, das sich zudem mit etlichen Berührungsängsten von außen konfrontiert sah, war Schlögels Besuch eine Geste der Wertschätzung und ein energischer Motivationsschub. Er war in den Jahren darauf immer wieder zu Gast bei unseren Veranstaltungen, so entwickelte sich nach und nach eine Freundschaft zwischen ihm und dem Institut.

Karl Schlögel, der in einer eigens von ihm kreierten und definierten Nische des sehr wortreichen, tiefsinnigen human- und geschichtswissenschaftlichen Reflexionsbetriebs zuhause ist – einem Feld, in dem vor allem eine Art mindfulness-artige Kunst des bloßen, nicht unmittelbar moralisch urteilenden, detailverliebten und zugleich assoziationsreichen Beobachtens und Aufschreibens gefragt ist –, hat zugleich keinerlei Mühe, sofort zu erkennen, wo klare Grenzen verlaufen: zwischen Freiheit und Knechtschaft, zwischen Gut und Böse, zwischen Täter und Opfer.
Er hat deswegen früh vor Putins Absichten gewarnt und gefordert, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. „Europa oder der Westen haben die Wahl: Er kann die Ukraine unterstützen und Widerstand gegenüber Putin leisten. Oder er kann die Ukraine preisgeben und vor Putin in die Knie gehen“, schrieb Schlögel. „Ohne eine freie Ukraine kann es keinen Frieden in Europa geben“, und empfahl jenen, die an einen Verhandlungsfrieden mit Putin glauben, sich einfach mal das russische Fernsehen anzuschauen.
Auf diese doppelte Dimension nahm in ihrer Laudatio indirekt die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja Bezug: „Ich hätte heute lieber über die Ursprünge von Karl Schlögels Prosa gesprochen, die so schön geschrieben ist. Aber der Krieg frisst Raum und Zeit.“
Auf diese herausstechende Eigenschaft, die sowohl sein Biogramm als auch seine Biografie prägt, hat auch die Jury in ihrer Begründung aufmerksam gemacht: In seinem Werk, so heißt es, verbinde „der deutsche Historiker und Essayist empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen. Als Wissenschaftler und Flaneur, als Archäologe …“ habe Karl Schlögel nach der Annexion der Krim durch Russland „seinen und unseren Blick auf die Ukraine geschärft und sich aufrichtig mit den blinden Flecken der deutschen Wahrnehmung auseinandergesetzt. Als einer der Ersten hat er vor der aggressiven Expansionspolitik Wladimir Putins und seinem autoritär-nationalistischen Machtanspruch gewarnt. Eindrücklich beschreibt er die Ukraine als Teil Europas und fordert auf, das Land um unserer gemeinsamen Zukunft willen zu verteidigen. Seine Mahnung: Ohne eine freie Ukraine kann es keinen Frieden in Europa geben.“
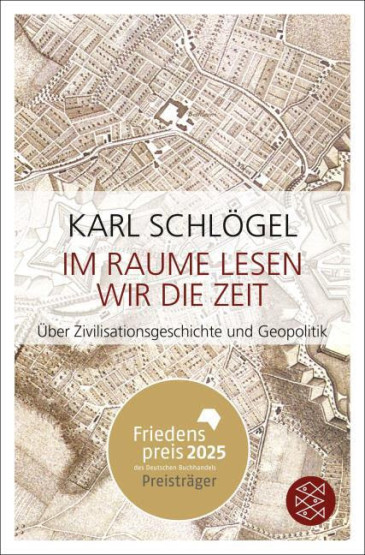
Worin besteht also der „Schlögelismus“, wenn man ihn denn als eigenes Genre fassen möchte? Karl Schlögels zentrale Kategorie ist die des Raums und seiner phänomenologischen Wahrnehmung, welcher er ein ganzes Werk gewidmet hat: "Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik." Ein Werk, das man auch als eine Abrechnung mit der Phase des „Post-Kitsch“ interpretieren könnte – wobei freilich nicht jedes mit dem Postmodernismus-Label versehene Werk automatisch zu letzterem dazugerechnet werden sollte. Schlögel nimmt hier explizit Bezug auf die Vorstellung vom Ende der Geschichte und, noch viel wichtiger, auf das vermeintliche Ende der Kategorie des Raums. Dabei beschreibt er seine eigene hermeneutische Methode, die er in vorherigen und nachfolgenden Werken anwendet, und exemplifiziert sie anhand mehrerer Dutzend Einzelstudien.
U.a. geht er den Grundrissen amerikanischer Städte auf den Grund und fragt, was diese über den amerikanischen Traum offenbaren. Eisenbahn, Auto und Flugzeug sieht er nicht einfach nur als Entwicklungsstufen und große Augenblicke einer progressiv interpretierten Zivilisations- und Wissenschaftsgeschichte; sie sind mehr als das. Sie haben gänzlich unseren Sinn für Raum, Zeit und Distanzen verändert.
Zugleich ist Schlögel die Neigung zu exzessiven Begriffs- und Diskurskreationen fremd. Das „Geraschel der Begriffe und Diskurse, das sich für die Wirklichkeit ausgibt“, gelte es als solches zu entschlüsseln. Um das Abstrakte niemals vom Konkreten vollends loszulösen, gleichen mancher seiner Werke kleinen Ausstellungen und Museen. Seine Quellen sind weit mehr als bloß andere Bücher: Fahrpläne, Adressbücher, Landkarten, Grundrisse, Familienalben, längst vergessene Zeitungsfragmente von den hinteren Seiten. Denn wenn Wort und Diskurs sich an der Realität abarbeiten sollen, müssen sie durch möglichst viele materiell echte Artefakte gefüttert und abgesichert sein. Einmal in den Konturen der zeitlich-räumlichen Wirklichkeit angekommen, lässt Schlögel dann auch gerne mal seiner Fantasie freien Lauf. Zum Ende hin von "Im Raume lesen wir die Zeit..." spaziert er mit Walter Benjamin im Los Angeles der 1940er Jahre ebenso wie mit Herodot im Moskau von 1937.
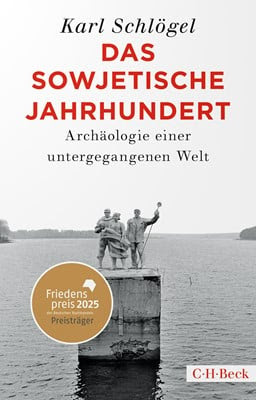
Dementsprechend ist seine Geschichtsdarstellung der Sowjetunion eine andere, als man sie irgendwo sonst antreffen könnte. "Das sowjetische Jahrhundert" erschien reich ausgestattet mit 86 Abbildungen und liest die Geschichte der Sowjetunion nicht einfach als Aneinanderreihung von Erkenntnissen, Handlungen und Protagonisten, sondern als Zusammenspiel von Raum und Zeit:„Jedes Imperium hat seinen Sound, seinen Duft, seinen Rhythmus, der auch dann noch fortlebt, wenn das Reich aufgehört hat zu existieren.“
Der Alltag in der Kommunalka, jener Gemeinschaftswohnung, in der verschiedene Familien in jeweils einem Zimmer lebten, „kultige“ Orte der sowjetischen Industrialisierung, die Bedeutung der Toilette oder des Telefons im repressiven System, die verführerischen Qualitäten des Parfüms „Rotes Moskau“ oder die brutalistischen Bauten der Industriestadt Magnitogorsk – all das gehört zu seinem erzählerischen Kosmos. Bei alledem sticht jedoch stets eine Qualität heraus: Bei aller literarischen Schreibkunst, Sinn fürs Räumliche, intellektuellem Flaneurertum und der Neigung, die Dinge „andächtig zu umkreisen, betrachten und belauschen“, wie es mal in einer Rezension seiner Bücher hieß, geht Schlögel nie der moralische Kompass verloren.
Das ist im Metier der Geisteswissenschaften keineswegs selbstverständlich, gerade in jenen Bereichen, wo die erste Komponente dieses Begriffs überragt. Nicht selten werden fehlende moralische Anteilnahme und eine angeblich wertneutrale, überhöhte Vogelperspektive als Erkenntnismehrwert verkauft. Nichts könnte Schlögel ferner sein. Das wieselsche „Man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten“ könnte auch ein schlögelisches sein. Dies stellen vor allem seine Werke "Der Russland-Reflex" und, wichtiger noch, "Entscheidung in Kiew: Ukrainische Lektionen" unter Beweis. Schon damals war für Schlögel klar, dass der deutsch-russische Wunschtraum der Annäherung krachend gescheitert war – und was auf dem Spiel stand, als viele noch, der russischen Propaganda auf den Leim gehend, über die „Krimfrage“ schwadronierten. Zu dem damaligen Zeit für Schlögel auch das: eine Art Selbstkritik.
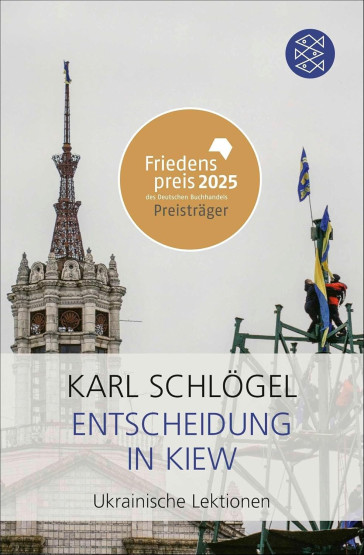
Schlögel hegte zu diesem Zeitpunkt keine Illusionen über Putins Imperialismus, den Informationskrieg und die Absicht, wie er sagte, ganze ukrainische Städte „auszulöschen“. Dennoch ging er davon aus, dass sich die russische Gesellschaft nicht zu einem militärischen Abenteuer hinreißen lassen würde. „Das war für mich nicht denkbar. Aus meiner Erfahrung war dieses Russland nach dem Ende der Sowjetunion so mit sich selbst beschäftigt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie diesem Aufruf, dass die Krim erobert werden soll, folgen würden.“ 2014 war für ihn dementsprechend eine Zäsur. Mit seiner Liebe zur städtischen Beobachtungskunst nimmt er den Leser mit auf eine Reise durch Lwiw, Odesa, Czerniwzi, Kyjiw, Charkiw, Donezk und Dnipro – auch um selbst so manches nachzuholen – und erkundet zusammen mit seinen Lesern diese ukrainischen Städte, die nicht weniger als eine „Kultur von eigenem Rang“ darstellen und die der Westen viel zu lange ignorierte, womit er letztlich auch Putin zu seiner Expansionspolitik ermutigte.
Richard Herzinger, an den wir noch vor wenigen Tagen einen Nachruf nach seinem für uns immer noch sehr mitnehmenden Tod schrieben, war übrigens auch von Schlögels Schaffen angetan – er empfand schon damals Schlögels ukrainische Städteporträts, Beobachtungen und Analysen als derart aufschlussreich, dass er sie in seiner Welt-Rezension "westlichen Staatslenkern auf den Nachttisch" wünschte. Er war im Übrigen auch zur gestrigen Preisverleihung eingeladen... .
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, seit 1950 eine der bedeutendsten kulturellen Auszeichnungen des Landes, wird am Schlusstag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging er an die amerikanisch-polnische Journalistin und Historikerin Anne Applebaum, der wir ebenfalls ein Kurzporträts widmeten.


Zobacz także
- Studentische Hilfskraft (w / m / d)
News
Studentische Hilfskraft (w / m / d)
Studentische Hilfskraft (w / m / d)
- Frohe Weihnachten!
News
Frohe Weihnachten!
Das Institut bleibt vom 22.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 geschlossen und ist ab dem 07.01.2026 wieder geöffnet.
- Richard Herzinger: Ein Patriot der Freiheit
News
Richard Herzinger: Ein Patriot der Freiheit
Gedenkrede und Fotos von Beisetzung
- Bekanntgabe
News
Bekanntgabe
Bekanntgabe des Ergebnisses des Auswahlverfahrens für die Leitung der Außenstelle des Pilecki-Institus
- Zum 86. Jahrestag der "Sonderaktion Krakau"
News
Zum 86. Jahrestag der "Sonderaktion Krakau"
Sie verkörpert das Wesen der deutschen Besatzung Polens: die Vernichtung der polnischen Bildungsschichten und damit der polnischen Identität. Zugleich erschließt sie universelle Lehren über die Handlungsmuster totalitärer Regime.
- Neuer Ukraine-Podcast!
News
Neuer Ukraine-Podcast!
OUT NOW! Folge 4: "Die Revolutionen von 1917-1921"
- Nachruf für Richard Herzinger (1955–2025)
News
Nachruf für Richard Herzinger (1955–2025)
Lieber Herr Herzinger, Sie werden uns sehr, sehr fehlen – mit Ihrer herzlichen, zugleich direkten Art, Ihrem unendlichen enzyklopädischen Wissen, Ihrer moralischen Klarsicht und Ihren stets bereichernden Beiträgen in so vielen Bereichen.
- Heute geschlossen
News
Heute geschlossen
Aus betrieblichen Gründen bleibt das Institut am heutigen Samstag, den 25. Oktober, geschlossen.
- Auswahlverfahren für die Stelle des Leiters des PIlecki-Instituts in Berlin!
News
Auswahlverfahren für die Stelle des Leiters des PIlecki-Instituts in Berlin!
Alle wichtigen Infos
- Zum Tag der Deutschen Einheit
News
Zum Tag der Deutschen Einheit
Liebe Freunde, alles Gute zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit!
- BREAKING - OFFIZIELLE ERKLÄRUNG
News
BREAKING - OFFIZIELLE ERKLÄRUNG
Das Pilecki-Institut gibt bekannt, dass Hanna Radziejowska und Mateusz Fałkowski ihre Arbeit in der Berliner Niederlassung wieder aufnehmen.
- Karol Madaj ist neuer amtierender Direktor des Pilecki-Instituts.
News
Karol Madaj ist neuer amtierender Direktor des Pilecki-Instituts.
Die Kulturministerin Marta Cienkowska berief ihn heute in diese Funktion.